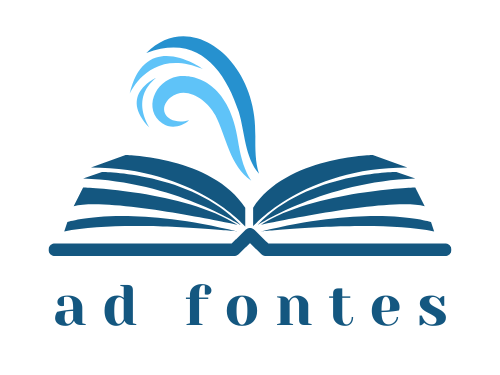Hunderte fromme und zugleich ehrliche Heiligenleben tummeln sich in dem Buch, das Generationen geprägt hat. Im deutschen Büchermarkt, der das Erbauliche durch kritische Heiligenviten ersetzt hat, bleibt das Format eine Rarität, auf die man immer zurückkommen kann.
Einige Zitate sind geboten:
Papst Gregor der Große – 12. März
Seit die Menschheit den Ehrentitel „der Große“ auch Männern zuerkannt hat, die nur groß waren in ihrem zügellosen Machtstreben, ist es angebracht, vorsichtig abzuwägen, wem dieses Wort wirklich zusteht. Aber wie rasch geht dieser Vorbehalt in das Gefühl der Bewunderung über für eine außergewöhnliche Persönlichkeit, wenn man das Leben des ersten Gregor, der die Kirche regierte, aufschlägt! Ist nicht schon sein Entwicklungsgang außergewöhnlich? Er war reich, der Sohn eines hochangesehenen römischen Senators und von Jugend auf in den Wissenschaften und in der Staatskunst geschult, aber das erklärt noch nicht die Tatsache, daß er schon mit dreißig Jahren die Würde eines Stadtpräfekten von Rom innehatte. Man muß an dem jungen Römer noch andere Eigenschaften gefunden haben, wenn man ihm zu einer Zeit, wo die Barbaren ganz Italien überschwemmten und alle Bande der Ordnung gelockert waren, das oberste Zivilamt der Stadt übertrug. Wenn er auch als Präfekt die Ehren seines Standes nicht mißachtete und mit Eifer seine Rechte ausübte, auf dem Grunde seines Herzens lebten eine tiefere Weisheit und eine größere Liebe als die hohe Politik. Unvergessen war, was ihm seine heiligmäßige Mutter Silvia an frommen Gedanken und Empfindungen gegeben hatte. Unvergessen waren auch die Ambrosius-, Hieronymus- und Augustinusstudien, die er als Jüngling betrieben hatte. Er brauchte nur zu der Einsicht zu kommen, wie sehr die Verpflichtung des Amtes bereits die religiösen Werte überwuchert hatte, um diesen sofort den Vorzug vor der Staatskarriere zu geben. In den entscheidenden Jahren seiner Wandlung war ihm das elterliche Vermögen zugefallen. Die Art und Weise, wie er es verwendete, zeigte bereits eine neue Gesinnung: denn nachdem die Ortsarmen einen gebührenden Anteil an der Erbschaft erhalten hatten, stiftete Gregor auf den sizilischen Gütern seines Hauses sechs Klöster und machte auch die väterliche Villa auf dem Cölius zu einer Niederlassung des Benediktinerordens, die er dem heiligen Andreas weihte. Nicht viel später. um das Jahr 575, trat er selbst als einfacher Mönch dort ein, wo er früher als Gebieter befohlen hatte.
Es war ihm sehr Ernst mit dem Mönchsideal. Ohne Rücksicht auf seine nicht sehr feste Gesundheit unterwarf er sich der ganzen Strenge seines Gelübdes. Die Kirche aber brauchte Männer wie ihn, die mit gründlicher theologischer Bildung diplomatisches Verhandlungsgeschick und würdiges Auftreten auch vor Königsthronen verbanden, aufs dringlichste zur Bewältigung der zahllosen Schwierigkeiten, die sich um sie auftürmten. Schon 577 wurde Gregor zum Archidiakon ernannt. Seine öffentliche Tätigkeit im Dienst der Kirche begann jedoch erst, als Papst Pelagius II. ihn 580 als Botschafter an den Hof von Konstantinopel sandte. …
– Hümmeler, Helden und Heilige, Papst Gregor der Große, 12. März
Margareta Maria Alacoque – (17.) 27. Oktober
Mußte erst diese junge Französin kommen, um uns wieder die Augen zu öffnen für eine der ältesten und schönsten Volksandachten, für die Herz-Jesu-Verehrung des Mittelalters? Die Völker des Abendlandes hatten die mystischen Gnadenschätze vergessen, die ihnen der Herr durch die Liebe seines Herzens geöffnet hatte, und die demütige Ordensfrau von Paray le Monial wurde nun seine Mittlerin bei der Menschheit. Durch sie erinnerte der Heiland die irrende Welt an das Geheimnis seiner Herzenswunde. Er wählte sich kein kluges, gelehrtes oder irgendwie aus der Masse hervortretendes Menschenkind dazu aus. Eine bescheidene, verachtete, unbekannte Ordensfrau durfte das Werkzeug seiner göttlichen Erbarmung sein. Der Dreißigjährige Krieg ging eben zu Ende, als Margareta Maria Alacoque als Tochter eines königlichen Richters und Notars in einem burgundischen Dörfchen geboren wurde. Sie war noch ein Kind, als ihr Vater starb und die Mutter, überlastet mit der Sorge für den Lebensunterhalt der Familie und die Erziehung von vier Kindern, sie den Urbanistinnen von Charolles anvertraute. Zwei Jahre lebte sie dort in guter Hut, hielt alle Klosterfrauen für Heilige und mühte sich ehrlich, es ihren Andachtsübungen nachzutun. Einer schweren Lähmung wegen mußte die Mutter sie zurückholen; vier Jahre lang lag das Kind hilflos auf dem Krankenlager, und alle ärztliche Kunst versagte. Da wandte man sich an die Helferin der Kranken und gelobte ihr, Margareta dem Dienste Gottes zu weihen, wenn sie die Gesundheit wiedererlange. Die Gottesmutter nahm das Gelübde an, die Lähmung wich, aber nur, um einer lange verhaltenen Vergnügungsfreude Platz zu machen. Das junge Mädchen atmete in vollen Zügen den berauschenden Duft der großen Welt ein, konnte aber ebenso gern Stunde um Stunde zu Füßen des Tabernakels knien und stumme Zwiesprache mit dem eucharistischen Heiland halten, der sich schon damals liebevoll ihrem kindlichen Gestammel offenbarte und sie bei Spiel und Arbeit immer seine unsichtbare Gegenwart fühlen ließ. Sein Werben um ihre Seele war auf die Dauer stärker als die Lockungen fröhlichen Jugendübermutes, stärker auch als die Möglichkeit einer vorteilhaften Heirat, die sie und ihre Familie mit einem Schlag aus der Bedrückung durch boshafte Verwandte gerettet hätte. Nach jahrelangem Kampf mit sich selbst schritt Margareta Maria Alacoque am 25. Mai 1671 über die Schwelle des Klosters von der Heimsuchung zu Paray le Monial und gab sich rückhaltlos dens Willen des Gekreuzigten hin, begierig, alle Pein mit ihm zu teilen. Von jetzt an hatte sie keinen anderen Lehrer und Meister als den Heiland selbst, der ihr näher war, als wenn sie ihn wie Thomas mit ihren Händen berührt hätte. Von ihm empfing sic die Anleitung zu einem vollkommenen Leben der Buße und Entsagung, von ihm auch die Kraft, in strengstem Gehorsam, in demütiger Verborgenheit und schmerzlichen Krankheiten den Kelch des Leidens bis zur Hefe zu leeren. Ihre hingerissene Andacht, ihre Schauungen und Abtötungen erregten den Argwohn ihrer geistlichen Vorgesetzten und Mitschwestern, die alles Außergewöhnliche als der Regel zuwiderlaufend scheuten und es nicht an Demütigungen jeder Art für die stille Schwester fehlen ließen. …
– Hümmeler, Helden und Heilige, Margareta Maria Alacoque